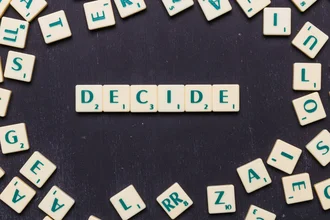Manipulation, Propaganda & Bewusstseinbeeinflussung
Dialektik
Dialektik (21)
Weiterlesen...Kritik
Die dialektische Vorgehensweise Hegels ist von Zeitgenossen und in der Nachfolge kritisiert worden. Schopenhauer sprach von der Philosophie Hegels abschätzig als „Hegelei“. Seit Kierkegaard ist eine Protesthaltung gegen das System der Dialektik nicht unüblich geworden. Auch der dialektische Materialismus war besonders in der politischen Diskussion des 20. Jahrhunderts heftig umstritten. Es trat insbesondere die Frage auf, wieso sich die ökonomische Gesellschaft zwangsläufig als Klassenkampf darstelle, der sich fortschreitend entwickele. 20 / 20 / 81
20 / 20 / 81Dialektik (22)
Weiterlesen...Die analytische Philosophie kritisierte zuallererst die dialektische Sprache, die sich aus Sicht der Sprachkritik nach der linguistischen Wende nicht an die Standards der formalen Logik halte. Man kann sogar sagen, dass die Feindseligkeit gegen oder Empfänglichkeit für Dialektik eines der Dinge ist, die im 20. Jahrhundert die anglo-amerikanische Philosophie von der sogenannten „kontinentalen Tradition“ spaltet – eine Kluft, die nur wenige gegenwärtige Philosophen (darunter Richard Rorty) zu überbrücken gewagt haben.
 21 / 21 / 81
21 / 21 / 81Dialektik (23)
Der analytische Philosoph Georg Henrik von Wright hat der Dialektik eine kybernetische Deutung gegeben, indem er Dialektik als Kette negativer Rückkopplungen deutet, die jeweils zu einem neuen Gleichgewicht führen. Anders als die Dialektiker versteht von Wright die Verwendung logischer Begriffe innerhalb der Dialektik als metaphorisch, wobei etwa „Widerspruch“ für Realkonflikte steht. Damit trägt er der Kritik an den Dialektikern Rechnung, nach der sie einer Verwechslung zwischen logischen Widersprüchen, die nur zwischen Sätzen und Propositionen bestehen können, und realen Gegensätzen unterliegen würden, etwa zwischen physikalischen Kräften oder auch gesellschaftlichen Interessen.
 22 / 22 / 81
22 / 22 / 81Eristische Dialektik (1)
Weiterlesen...Als Eristische Dialektik wird allgemein ein um 1830 begonnenes Manuskript von Arthur Schopenhauer betitelt, in dem er diese (im Manuskript auch als Eristik bezeichnet) als eine Kunstlehre beschreibt, um in einem Disput per fas et nefas (lateinisch für „mit erlaubten und unerlaubten Mitteln“) als derjenige zu erscheinen, der „Recht hat“. Zu diesem Ziel gibt er 38 rhetorische Strategeme an (von ihm „Kunstgriffe“ genannt), die folglich nicht etwa der Wahrheitsfindung dienen, sondern durch bestimmte argumentative Formen ausschließlich Erfolg in einem Streitgespräch versprechen. Diesen Zweck hätten auch klassische Sophismen; einige davon werden von Schopenhauer ebenfalls angeführt. Er erwähnt das damals unvollständige Manuskript mit den ersten neun „Kunstgriffen“ 1851 in Parerga und Paralipomena. Dort erläutert er aber, warum er bisher von einer Veröffentlichung absah. Er ergänzte und baute dieses Manuskript zwar weiter aus, beließ es aber bei „etwa vierzig“ Kunstgriffen (tatsächlich sind es 38), weil er sich angewidert sah, „alle[r] dieser Schlupfwinkel der mit Eigensinn, Eitelkeit und Unredlichkeit verschwisterten Beschränktheit und Unfähigkeit“ zu beleuchten […] „daher ich es bei dieser Probe bewenden lasse“: Eine Veröffentlichung unterließ er deshalb zu seinen Lebzeiten, es wurde erst postum (und dies nicht in seiner originalen Form) 1864 bekannt; die originale Form erst nach 1966.
 23 / 23 / 81
23 / 23 / 81Eristische Dialektik (2)
Weiterlesen...Überblick
In der Arbeit werden u. a. die seit der Antike verwendeten philosophischen Grundbegriffe Eristik (Lehre vom Streitgespräch) und Dialektik (Kunst der Unterredung) angesprochen. Die von Schopenhauer selbst in der Einleitung als Eristische Dialektik bezeichnete Disziplin – in dieser spricht er auch von der „Kunst, Recht zu behalten“ – ist eine Unterdisziplin der Rhetorik. Schopenhauer hat die eristische Dialektik selbst nie veröffentlicht; sie wurde erst im Nachlassband 1864 zusammen mit anderem Material von Julius Frauenstädt publiziert. 24 / 24 / 81
24 / 24 / 81Eristische Dialektik (3)
Weiterlesen...Die im Text beschriebenen 38 Kunstgriffe sind rhetorische Strategeme, mit deren Hilfe in einem Disput, einer Debatte oder Diskussion Zustimmung beim Publikum oder sogar vom Gegner erzeugt werden kann, indem die eigene Position plausibel gemacht oder die Plausibilität des Gegners untergraben wird. Die Strategeme sollen unabhängig von der Wahrheit der vertretenen Position erfolgreich sein. Schopenhauer entwirft damit eine Kunst, von anderen Recht zu bekommen oder es gegen Angriffe anderer zu behalten, für die zwar noch keine Wissenschaft, wohl aber eine Naturanlage und ein natürliches Interesse bei allen Menschen bestehen soll. Frauenstädt gibt dabei folgendes Zitat:
„Eristik wäre demnach die Lehre vom Verfahren der dem Menschen natürlichen Rechthaberei […]. Die angeborene Eitelkeit, die besonders hinsichtlich der Verstandeskraft reizbar ist, will nicht haben, dass was wir zuerst aufgestellt [haben] sich als falsch und das des Gegners als Recht ergebe.“
– Schopenhauer in der Fassung von Frauenstädt, nicht originaler Text 25 / 25 / 81
25 / 25 / 81Eristische Dialektik (4)
Weiterlesen...Eristik, Logik und Dialektik
In einer vermutlich als Einleitung geplanten Passage geht Schopenhauer auf das Spannungsverhältnis der beiden Begriffe Logik und Dialektik ein, da dieses sowohl pragmatisch als auch die geistige Basis von Streitgesprächen und Argumenten beeinflusse. Dazu geht Schopenhauer zunächst auf die Begriffsgeschichte, dann jedoch auf den Bedeutungsunterschied ein.
Schopenhauer stellt fest, dass Logik und Dialektik schon von den Denkern der klassischen Antike als Synonyme gebraucht wurden, obgleich die namensgebenden Verben logízesthai (gr.; „überdenken, überlegen, berechnen“) und dialégesthai (gr.; „sich unterreden“) unterschiedliche Tätigkeiten beschreiben. 26 / 26 / 81
26 / 26 / 81Eristische Dialektik (5)
Weiterlesen...Die synonyme Verwendung von Logik und Dialektik habe sich bis zur Zeit Schopenhauers erhalten. Er berichtet jedoch, dass durch Kants Definition der Dialektik als „Logik des Scheins“ seit dem Ende des 18. Jahrhunderts „Dialektik“ oft im negativen Sinn gebraucht werde, für Täuschungsstrategeme einer „sophistischen Disputierkunst“. Für die alte Bedeutung werde die „unschuldigere“ Benennung „Logik“ bevorzugt, ohne dass inhaltlich klare Unterschiede bestünden.
 27 / 27 / 81
27 / 27 / 81Eristische Dialektik (6)
Weiterlesen...Schopenhauer bedauert die zu seiner Zeit übliche synonyme Verwendung von Logik und Dialektik. Die Logik beinhaltet aus seiner Sicht die enge Verbindung von Wort und Vernunft. Sie sei zu definieren als „die Wissenschaft von den Gesetzen des Denkens, d. h. von der Verfahrensart der Vernunft“. Die Logik behandle einen a priori bestimmbaren Gegenstand ohne Empirie und entstehe „beim einsamen Denken eines vernünftigen Wesens“. Die Dialektik sei hingegen zu verstehen als „die Kunst zu disputieren“. Sie handle „von der Gemeinschaft zweier vernünftiger Wesen“, deren Gespräch aufgrund ihrer empirisch bedingten (d. h. „von individuellen Erfahrungstatsachen geprägten“) Verschiedenheit zu einem „geistigen Kampf“ wird. Dialektik sei größtenteils a posteriori ableitbar „aus dem Erfahrungswissen über die Störungen, die das reine Denken durch die Verschiedenheit der Individualität beim Zusammendenken zweier vernünftiger Wesen erleidet“ und den „Mitteln, welche Individuen gegeneinander gebrauchen, um jeder sein individuelles Denken, als das reine und objektive geltend zu machen“.
 28 / 28 / 81
28 / 28 / 81Eristische Dialektik (7)
Weiterlesen...Um Missverständnisse zu vermeiden, verwendet Schopenhauer den Begriff Eristische Dialektik für Streittechniken oder Strategeme, die nicht der Wahrheitsfindung oder dem wechselseitigen Verständnis dienen. Er unterstellt dem Menschen, „von Natur aus rechthaberisch“ zu sein, und bezeichnet die Dialektik dementsprechend als „Lehre von den Verfahren bezüglich der dem Menschen natürlichen Rechthaberei“.
Die Bedeutungen von Logik und Dialektik sind nun dadurch klar voneinander abgegrenzt. Dies ist aber eher eine Folge der Neubestimmung der Dialektik durch Schopenhauers Rivalen Hegel. 29 / 29 / 81
29 / 29 / 81